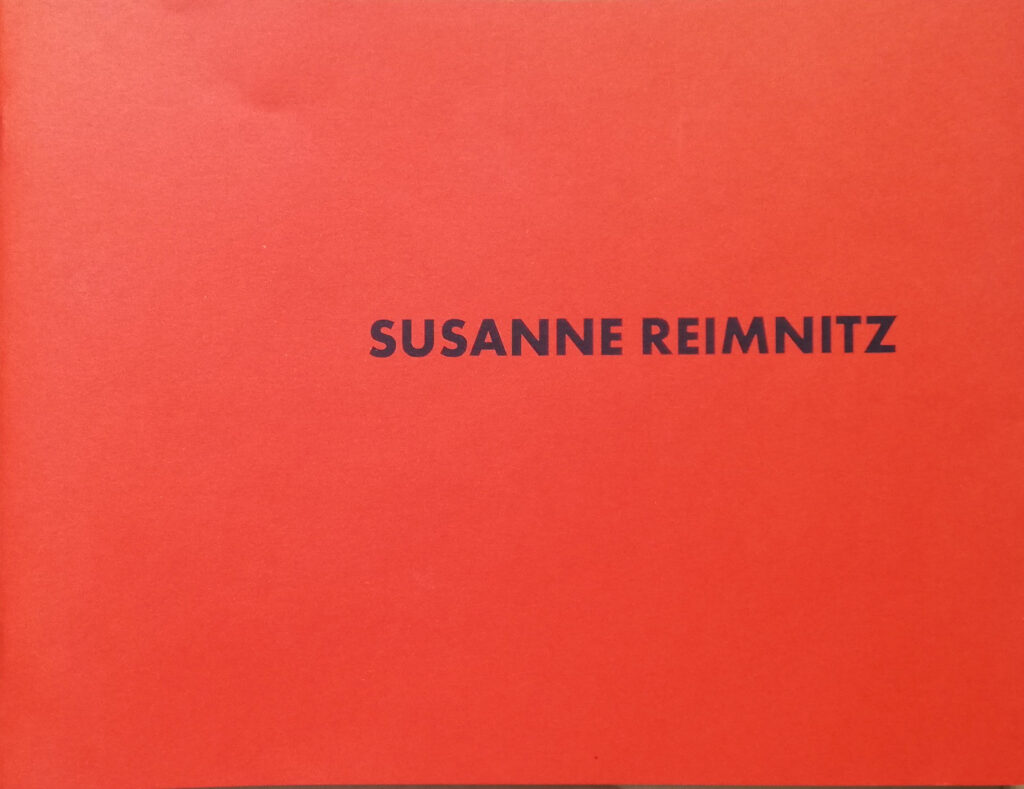Eröffnungsrede
Tilman Raabke, Dramaturg
Ausstellung
„Arbeiten auf Papier“ von Susanne Reimnitz, 1990
Publikationen
GESTALTEN AUS DEM ZUSAMMENHANG
Wenn man nach der Anzahl der hier ausgestellten Arbeiten geht – es sind neue Arbeiten von Susanne Reimnitz: ARBEITEN AUF PAPIER – wenn man also nach der Anzahl der Blätter geht, scheint es sich um 29 Werke zu handeln, aber vielleicht hätte man sich damit auch schon verzählt. Denn die hier ausgestellten Arbeiten geben sich auf eine eigentümliche Weise ihre Anwesenheit: nicht in jener Gebärde des atemlosen Identischen, welche die Zeit verschlingt und das absolute Territorium eines Raumes schafft, der DAS KUNSTWERK heißt – keine solche Anwesenheit also. Sondern eine merkwürdig vor sich selbst zögernde Präsenz, die sich eher zwischen den Arbeiten hin und her bewegt, als sich mit einer einzelnen endgültig identifizieren zu wollen.
Bezüge springen nämlich ins Auge, welche die Bilder zu einer vagen Folge machen: Man entdeckt einen Zusammenhang zwischen zwei Arbeiten, der plötzlich zum Beginn einer ganzen Reihe wird, die man dann vielleicht über vier oder über acht Arbeiten oder noch weiterverfolgen kann, ohne dabei übrigens ganz sicher zu sein. So scheinen sich die Bilder selber hinter ihren Bezügenverstecken zu wollen, nicht etwa vor fremden Blicken, gegen die sie unempfindlich sind, sondern vor jener Gebärde des atemlos Identischen, die DAS KUNSTWERK bedeutet und die sie an einem einzigen zeitlosen Ort festnageln würde.
Susanne Reimnitz spielt also mit dem Werkbegriff (der ohnehin selbst schon doppeldeutig genug ist), mit den Begriffen von Thema und Variation, von Zyklus und Reihenbildung. Das Problem ist natürlich alt: MAN KANN (nach Heraklit) NICHT ZWEIMAL ÜBER DEN BODENSEE REITEN; aber DIE KUNST IST (nach Richard Wagner) EIN REITENDER HOLLÄNDER. Das Problem scheint alt; Susanne Reimnitz löst es jedenfalls auf eine neue Weise. Und da ihr Spiel mit dem Werkbegriff nicht bloß äußerlich, nicht nur ein inzwischen längst üblicher Modegag ist, findet es seinen inneren Grund im Thema der hier ausgestellten Arbeiten.
I. Zunächst fällt es allerdings schwer, diesen Arbeiten überhaupt etwas wie ein Thema anzusehen. Sie sind ungegenständlich und zeigen kein Abbild der Faktenwelt, an das man sich halten kann: Keine Schneelandschaft wird in diesen Bildern dargestellt; keine toten Zitronen liegen da; niemand leidet unter Magenschmerzen; keine schwergewichtige Opernsängerin präsentiert sich; kein reitender Bote des Königs erscheint im letzten, rettenden Augenblick.
Wenigstens kann man hin und wieder etwas aus der Zeichenwelt erkennen: ROSA steht auf einem Bild, aber wer weiß, was das bedeuten soll – eine fremdsprachige Blume oder Rosa Luxemburg, den Maler Salvator Rosa oder nur die Farbe Rosa, EIN ROT GERINGER SÄTTIGUNG. Die Farben des betreffenden Bildes sind eher geschmiert. Auch die Zahlen, die man manchmal erkennen kann, sind nicht sehr ordentlich geschrieben und wirken wie Marginalien, die das Antlitz der Bilder eher verwischen.
Die Bilder selbst fangen den Blick mit einer anderen Art von Gestalt ein. Auf eine etwas unangenehme Weise ziehen sie sich fast auf einen Punkt – nein: auf einen Fleck zusammen, aus dem das Bild (langsam; wie Bilder pflegen) zu expandieren scheint. Ein hartnäckiger Fleck auf der weißen Weste eines unbeschriebenen Blattes, das vielleicht doch nicht so unschuldig ist, wie es tut.
Auf dem Einladungskarten -Bild zum Beispiel gibt es diese kleine Eiform, deren Kontur betont unsorgfältig durch eine überwiegend schwarze Fläche ausgemalt ist, die ihre Herkunft aus dem Mischding der Schraffur noch deutlich verrät. Dahinter ein roter Strich. Und dann noch etwas von verwaschenem, hellen Blau. Ein in sich widerborstiger Fleck also: der graphische Umriß gegen die malerische Fläche, der kräftige, eindeutige Strich gegen das formlose, schwächliche Blau und dieser farbige Kontrast gegen den inneren Kontrast der im Schwarz zusammenhängenden Eiform.
Geht man den verschiedenen Bildern von Susanne Reimnitz nach, kann man in diesen Flecken, diesen Zentralnebeln, jeweils die verschiedenen Gestalten einer einzigen Form erkennen: Gegensatz, Widerspruch, Kontrast, Diskrepanz, Ungleichheit – die Gestalten der Differenz also, die ( als was immer sie sonst aufgefaßt sein wollen) in der Bilderwelt die spannungserzeugenden Bauelemente der ungegenständlichen, der modernen, der Kunst überhaupt bedeuten. Dann wären diese Flecke vielleicht selber schon Bilder. Aber dazu fehlt etwas, und es kommt etwas hinzu.
Was fehlt, ist der Zusammenhang dieser Gestalten mit dem Papierformat: eben die Gebärde, die sich – zwar mit den Mitteln der Differenz, aber im unzweideutigen Zugriff – den Blattrand bedingungslos unterwirft und zu eigen macht und sich flächendeckend als jenes atemlos Identische konstituiert, das DAS KUNSTWERK ist, ein sich stolz präsentierendes Territorium des Raums in der Schweigezone der Zeit. Diese Gebärde fehlt den Gestalten aber. Wären sie Punkte, gäbe es wenigstens nichts an ihnen zu zweifeln, aber als Fleck sind sie nur die vom Identischen verlassene Differenz. Nicht etwa kraftlose Gestalten – im Gegenteil von einem störrischen Heroismus. Aber mit dieser Haltung einsamer Größe stehen sie doch etwas verloren in der weiten Schneelandschaft der Blätter. Dennoch dürfen sie getrost sein: Der reitende Bote des Königs erscheint, wie immer, im letzten, rettenden Augenblick.
In dem Augenblick nämlich, in dem die Differenz dieser Gestalten nicht mehr als das räumlich Identische gebannt ist, verändern sie ihr Antlitz: Der rote Strich ist jetzt nicht mehr hinter der schwarzen Eiform gelegen, sondern früher gemalt worden. Im Mittel der Überschneidung realisiert sich die Differenz jetzt nicht mehr als die Lage in dem EINEN RAUM, den es jetzt gar nicht mehr gibt, sondern als die Folge in der EINEN ZEIT. IHR MÜSST HIER NICHT EWIG ERFRIEREN, SAGTE DER BOTE, IHR WERDET SCHNELL GERICHTET. Die Zeit bedeutet hier also keine Rettung, sondern nur den anderen Zwangstraum des Identischen, das seine Mittel der Differenz jetzt nur noch brutaler zu gebrauchen weiß, nicht als räumliche Lehnsherrschaften, sondern als eine zeitgemäße Politik, die keine Gefangenen macht. Jedes Neue schafft noch mehr Gewalt als das Alte, um es zu überwinden: Ein roter Strich genügt nicht mehr; am Ende steht die Ausradierung in Schwarz.
Susanne Reimnitz zeigt uns die Gestalten der Differenz, die dialektische Strafarbeit des Identischen, den reitenden Holländer (die Kunst), der sich IM NAMEN DES VATERS fortwährend in die Flanken seines Pferdes schreibt: DU SOLLST NICHT LÜGEN. Aber sie zeigt sie uns mit dem bezaubernden Lächeln einer Bigamistin: als Gestalten aus dem Zusammenhang. Ob sie nun aus dem Zusammenhang herausgelöst werden – sie leben in einem seltsamen Zwischenreich, in dem sich Identität und Differenz und Raum und Zeit ständig verwischen und morganatische Mischformen zeugen.
Neben unserm Fleck auf dem Einladungskarten-Bild, erscheint er selbst als sein eigener Zwilling, wodurch das Bild, aus dem Zentralnebel expandierend, in Bewegung kommt. Die Kontur ist nicht mehr überwiegend schwarz, sondern hat sich mit dem schwachen, hellen Blau vermischt. Sie wird etwas durchsichtig, wie die schwarze Malfläche, die vom Blau vor allem die dekonzentrierende Formlosigkeit angenommen hat. Auch die Gewichtung verschiebt sich: Die Malfläche beherrscht den graphischen Umriß nicht mehr; der ins Horizontale gekippte Bogen ist so sehr geweitet, dass das Schwarz aus dessen Mitte an den unteren Rand rutscht.
Diese Gestalt gewinnt viel mehr Raum – aber nur, weil sie sich mit dem Weiß des Blattes zu verbünden weiß, statt es flächendeckend zu beherrschen. Sie wird dabei so transparent, dass ihr graphischer Umriß ganz allein oben aus dem Zentralnebel heraus und unten zu ihm zurückzuführen scheint. Nur das Zwischenspiel einer Linie also ? Oder wölbt sich hier eine neue Eiform aus der alten ? Oder ist es dieselbe, einige Minuten später ?
Der rote Strich jedenfalls scheint zu dem schwarzroten Pfeil geworden zu sein, der einer graphisch vagen Bezeichnung untersteht: EIN VIERTEL. Aber dieser Pfeil ist kein einfacher Gegensatz zu der neuen Eiform mehr, obwohl er sich auch in dieser Pose gefällt und kokett mit ihr spielt. Er läßt den Zentralnebel aber gerade nicht nach allen Seiten zum Bildrand ausgreifen, um sich stolz und überall als das Identische der Differenz zu präsentieren, sondern wölbt sich über die expandierende Bild- Bewegtheit der beiden Eiformen hinweg: ein Wegweiser, der über allem steht; ein Zeitpfeil auf der Metaebene, der die Regel angibt: BEWEGUNGSKURVE UND TEMPO DER HANDELNDEN IM RAUM, hier vielleicht im 1/4-Takt.
In dem Maß, in dem sie an räumlicher Schwere verlieren, an dem Ernst der bedeutenden Gebärde, hören die Arbeiten von Susanne Reimnitz ihre innere Bewegtheit, ihre eigene Zeit, die sie sich als eine leichtere, heitere Musik erzählen. Eine andere Gestalt des Zeitpfeils sind, neben den Zahlenreihen, die Folgen fast-paralleler Striche verschiedener Länge, verschiedener Höhe, verschiedener Kräftigkeit: Diese Strichfolgen – besonders deutlich in dem Endbild der Dreierfolge – erscheinen wie Partituren. Denken Sie zum Beispiel an die SONGBOOKS von John Cage. Hier sind sie die Partitur einer Musik, die sich das Bild in seiner inneren Bewegtheit selbst erzählt, in seiner ANDEREN ZEIT also, die sich im Zwischenraum fortbewegt, indem sie die EINE ZEIT des stumpfsinnigen Metronoms verschweigt. Und während die schwergewichtige Opernsängerin sich dort auf der linken Hälfte der Bühne noch ziemlich dramatisch gebärdet, gerade weil der schwere Stoff ihres großartigen Kostüms sie behindert, ist ihr die Musik längst und leichten Herzens entflohen.
III. Was die Musik dieser Bilder sich erzählt, deren innere Bewegtheit, ist eine liebevolle Dekonstruktion des Raumes, der nun viel entspannter zu sein scheint, indem sie sich ihm in einer schüchternen Geste zuneigt.
Und so erweist sich der Zeitpfeil im Einladungskarten -Bild zuletzt gerade nicht als Wegweiser, der erhaben und mahnend über allem steht und der Expansion ihr Maß vorschreibt, sondern er verbindet sich mit jener letzten, kaum noch sichtbaren Gestalt rechts unten, die wahrscheinlich das Schönste an diesem Bild ist. Ließen sich die beiden einander zuwendenden Gestalten weiterführen, wären sie eine neue, dann sicher alles umschließende Eiform. Sie sind dies auch, aber nicht in jener stolz und brutal präsentierenden Gebärde des Identischen, sondern nur in einem zärtlichen Andenken. So verbindet sich jener Pfeil mit einer Gestalt, die ihn zu nichts nötigt.
Kaum noch sichtbar, ist unser Zentralnebel in dieser, vorläufig letzten, Gestalt zu einer schwarzen Linie geworden, die allen schweren Ernst der bedeutenden Gebärde abgelegt hat und in ihrer leichten Hebung hinauf und aus dem Papier hinaus schwebt. So sehr selbstvergessen, daß sie ganz in das Blatt versunken ist, statt es sich flächendeckend zu unterwerfen. Aber auch das Blatt rächt sich nicht, tritt nicht als böses Deck-Weiß auf, sondern weiß aus sich herauszugehen und sich für die schwarze Linie transparent zu machen. So verschwistert, teilen sie DEN SCHÖNEN HIMMEL, DEN SIE KURZ BEFLIEGEN / DASS ALSO KEINES LÄNGER HIER VERWEILE / SO MAG DER WIND SIE IN DAS NICHTS ENTFÜHREN. Hier, genau hier, hat Susanne Reimnitz dem Bild ihren Namen geliehen.
Susanne Reimnitz zeigt uns in ihren ARBEITEN AUF PAPIER, in vielen verschiedenen Akzenten, wie sich die Gebärde des Bedeutenden – eine Gebärde, die gewaltsam dazu drängt, sich starr zu verfestigen – wie sich diese Gebärde aufheben läßt. Wenn dies gelingt – und Susanne Reimnitz gelingt es – beginnen die Dinge zu schweben. Aber natürlich sind dies gar keine richtigen Dinge: Keine Opernsängerin präsentiert sich in diesen Arbeiten; kein Reiter über den Bodensee reißt seinen Rappen noch einmal herum, weil er schon wieder das Ufer erspäht. Es handelt sich also nicht um ein GUMMITIER AUS EINEM VERGNÜGUNGSPARK, DAS SICH VON SEINER LEINE LOSGERISSEN HAT, aber vielleicht um EIN STÜCK ANTARKTIS AUF DEM HEIMFLUG. Jedenfalls kommen diese Gestalten – erstmal in Schwebe gebracht – zu einer so leichten Präsenz, dass sie sich eher zwischen den Blättern hin und her bewegen, als sich mit einem einzelnen endgültig identifizieren zu wollen. Wahrscheinlich muß Susanne Reimnitz selber ihren Arbeiten zuletzt in der Luft nachgehen, um sie, wenigstens für kurze Zeit, auf ihren Papieren einzufangen. Wie sie das macht, bleibt jedoch ihr Geheimnis.
Katalog „Susanne Reimnitz“
Autor
Michael Mayer, Publizist
Herausgeber
Schön-Kunst, Bad Säckingen
Satz & Druck
Vetter Druck, Murg
Herausgabe
1996
In flagranti
Ich habe sie mir also angesehen. Die Bilder. Immer wieder. Ich habe sie immer wieder hervorgeholt und wieder weggelegt, verstört durchaus, konsterniert und manchmal auch ein wenig ratlos, ein wenig verunsichert, ob ich etwas dazu zu sagen habe. Ich habe sie mir angesehen und mich –wie so oft– gefragt, was ich hier sehe, und ob ich überhaupt etwas sehe. Sehe ich etwas ? Irgendetwas ?
Sehe ich, beispielsweise im Bild Nr. 12 (ein Bild als „Beispiel“ – das ist wie immer heikel), sehe ich diese vertikal aufgetragenen Flächen, die sich wie ein Schleier übereinanderzulegen scheinen ? Farbflächen, horizontal von einer Art gelblichem Band durchzogen, von Gravuren gezeichnet und abermals, im linken oberen Teil des Bildes, von einer nahezu rechteckigen braunen Fläche befleckt, die ihrerseits, fast keusch, etwas zu verbergen oder übertüncht zu haben scheint, ein helleres Braun, ein Rotbraun, das sich nochmals, ungefähr in der Mitte des Bildes, halbversteckt, man könnte meinen verschämt gar, ankündigt ? Was sehe ich da in verschiedenen, von einem Weißrosa unterbrochenen Grüntönen, in gemischten ineinanderlaufenden Farben, in diesem gemischten oder auch verwischten Grün ? „Grasgrün“, notierte mir Susanne Reimnitz auf der Rückseite des Fotos von Nr. 12, das sie mir mit all den anderen zusandte, als wollte sie verhindern, daß die fotografische Reproduktion mit ihren Effekten – hier mit ihrem Zug ins Gelbstichige – die Oberhand behiel- te über die Farben selbst, über das Grün, das, so Reimnitz, „dunkler“ sei, „Grasgrün“ eben. Grasgrün wie Gras, das man an einem heißen Sommertag mäht und dessen Geruch einem noch in der Nase ist, wenn man sich längst anderswo aufhält. Als ob man einen Geruch erinnerte. Als ob bliebe und dauerte, was mehr als alles andere flüchtig ist und vergeht.
Kann man Bilder riechen ? riechen Bilder ? Ich meine nicht das chemische Substrat, die Farben als deren materiale Substanz, sondern die Farbe, die man sieht und nur sieht.
Kann man, indem man sieht und nur sieht, die Bilder riechen, das „Grasgrün“ beispielsweise ? Kann man „das“ sehen ? Ich glaube schon. Und ich glaube, daß das Geheimnis der Bilder von Susanne Reimnitz – dieser eigentümliche und so nachhaltige Eindruck des fast Schwerelosen, des schwebend und allmählich doch zu Boden sinkenden Leichten – auch mit Gerüchen zu tun hat, mit Düften und Aromen, überhaupt mit all dem Ephemeren, dem Beiläufigen und Geringen, das wir, kaum daß wir es wahrnehmen, mißachten, das uns um- und einhüllt wie ein Hauch, ein Atem, ein Dunst, das uns umgibt wie ein Wind, wie ein Rauschen oder ein leiser Regen. Mit demjenigen mithin, von dem es gemeinhin schwerfällt zu sagen, es sei „etwas“. Weder „etwas“ und doch nicht „nichts“: wie der Geruch von Gras, das man an einem heißen Sommertag mäht.
Ich habe mich bis zur Blindheit gefragt, was ich sehe, ob ich etwas sehe, und ob ich überhaupt sehe. Bis zur Blindheit, um das Sehen zu sehen und – um zu sehen.
In diesen Bildern ertappt man das Sehen selbst, bei und in sich, die weithin offenen Augen, die einfach wahrnehmen, was ist. Einfach wahrnehmen, als ob das so einfach wäre. In diesen Bildern herrscht die Inständigkeit eines Blicks, der dem inne zu sein versucht, was sich ihm gibt. Das leichte und deshalb Leichtverletzliche, das Leise, ohnehin kaum der Rede wert und ein Licht, das in ein Dunkel fällt, ohne es zu verraten. Ein Licht, das das Dunkel allererst Dunkel sein läßt. Ein Licht als Hüter des Dunkels, der Farbschatten auf raumöffnenden Flächen, die sich in immer neuen, prekären Balancen versammeln, fragil, ohne zu zerbrechen. Diese Bilder hüten ihr Geheimnis, indem sie es preisgeben. Indem sie es einem anderen übereignen, dessen Gesicht stets unbekannt sein wird. Der sich ihnen zuwendet, um sich bis zur Blindheit zu fragen, was, er sieht und ob er etwas sieht und ob er überhaupt sieht. Der sich ihnen zuwendet, um endlich – zu sehen.